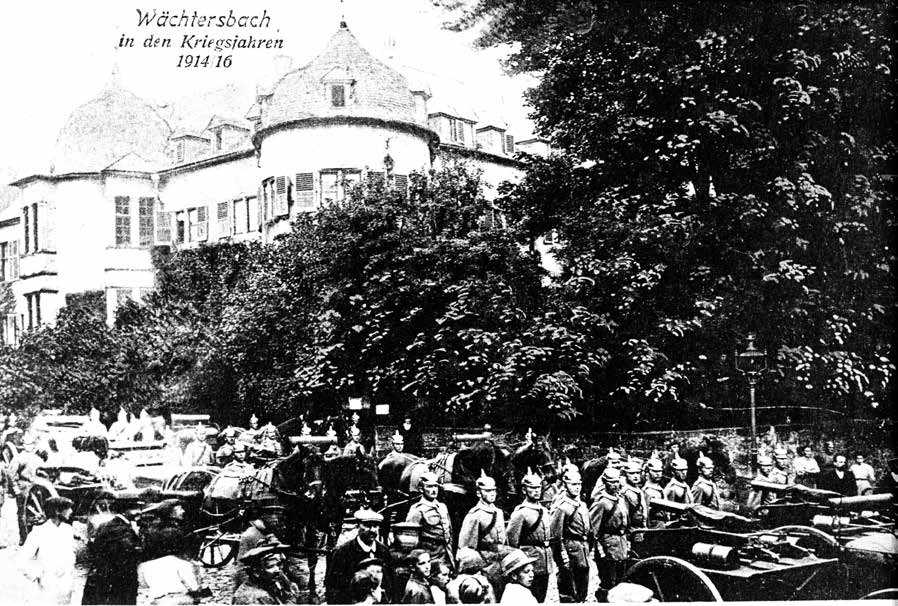Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Burg bis zur Renaissance weitestgehend unverändert geblieben. Die Umbaumaßnahmen im 15. und 16. Jahrhundert gaben dem Bauwerk dann annähernd sein heutiges Erscheinungsbild. Nach den von Graf Diether durchgeführten tiefgreifenden Umgestaltungen und Neubauten wurden immer wieder einige Schlossteile umgebaut und ergänzt, in seltenen Fällen auch abgerissen. Graf Anton von Ysenburg-Büdingen-Ronneburg (* 1501, † 1560) wird der Bau der beiden Ecktürme und des Halbrundturmes mit den drei Erkern und dem Eingangsportal zugesprochen. Eine andere Quelle besagt, dass er den nordöstlichen Turm entfernen ließ, um das Gebäude zur Bergseite hin zu erweitern. Die Ausschmückung des kleinen Innenhofes und die Aufstockung einzelner Gebäudeteile sollen ebenfalls auf sein Geheiß realisiert worden sein. Der Charakter der Wasserburg soll weiter erhalten geblieben sein. Über die Lebensdaten des Grafen gibt es nur wenige zuverlässige Quellen, da eine vollständige Biografie fehlt. Gesichert scheint nur zu sein, dass bei ihm familiäre Streitigkeiten und später nach der Reformation auch konfessionelle Auseinandersetzungen an der Tagesordnung waren. Entgegen der testamentarischen Verfügung von Ludwig II. blieb das Erbe der Ysenburger nicht in einer Hand, sondern wurde 1517 in eine Ronneburger und eine Birsteiner Linie geteilt. Graf Anton von Ysenburg-Büdingen-Ronneburg wird auch als Begründer der Teilgrafschaft Ysenburg-Ronneburg genannt. Zunächst wurde die vom Erblasser gewünschte Einheit der Grafschaft jedoch scheinbar weiter durch die Erben aufrechterhalten. Das vorher leerstehende Wächtersbacher Schloss wurde nach dem Umzug des Grafen und seiner Frau Gräfin Elisabeth zu ihrer Residenz ausgebaut. Dazu wurden die oben genannten Änderungen und Umbauten am Gebäudekomplex vorgenommen.
Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Burg bis zur Renaissance weitestgehend unverändert geblieben. Die Umbaumaßnahmen im 15. und 16. Jahrhundert gaben dem Bauwerk dann annähernd sein heutiges Erscheinungsbild. Nach den von Graf Diether durchgeführten tiefgreifenden Umgestaltungen und Neubauten wurden immer wieder einige Schlossteile umgebaut und ergänzt, in seltenen Fällen auch abgerissen. Graf Anton von Ysenburg-Büdingen-Ronneburg (* 1501, † 1560) wird der Bau der beiden Ecktürme und des Halbrundturmes mit den drei Erkern und dem Eingangsportal zugesprochen. Eine andere Quelle besagt, dass er den nordöstlichen Turm entfernen ließ, um das Gebäude zur Bergseite hin zu erweitern. Die Ausschmückung des kleinen Innenhofes und die Aufstockung einzelner Gebäudeteile sollen ebenfalls auf sein Geheiß realisiert worden sein. Der Charakter der Wasserburg soll weiter erhalten geblieben sein. Über die Lebensdaten des Grafen gibt es nur wenige zuverlässige Quellen, da eine vollständige Biografie fehlt. Gesichert scheint nur zu sein, dass bei ihm familiäre Streitigkeiten und später nach der Reformation auch konfessionelle Auseinandersetzungen an der Tagesordnung waren. Entgegen der testamentarischen Verfügung von Ludwig II. blieb das Erbe der Ysenburger nicht in einer Hand, sondern wurde 1517 in eine Ronneburger und eine Birsteiner Linie geteilt. Graf Anton von Ysenburg-Büdingen-Ronneburg wird auch als Begründer der Teilgrafschaft Ysenburg-Ronneburg genannt. Zunächst wurde die vom Erblasser gewünschte Einheit der Grafschaft jedoch scheinbar weiter durch die Erben aufrechterhalten. Das vorher leerstehende Wächtersbacher Schloss wurde nach dem Umzug des Grafen und seiner Frau Gräfin Elisabeth zu ihrer Residenz ausgebaut. Dazu wurden die oben genannten Änderungen und Umbauten am Gebäudekomplex vorgenommen.
 Die Gründung der Wächtersbacher Brauerei auf dem Gelände des Schlosses fiel in die Zeit nach Graf Antons Tod. Schon vor 1578 war Bier in kleineren Mengen nur zum Verzehr des kleinen Hofes, seiner Herrschaften und Diener gebraut worden, wie Otto Friedrich Fürst zu Ysenburg und Büdingen in seinem Flyer anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der Fürstlichen Brauerei Schloss Wächtersbach erklärte. Auch in Büdingen, Birstein und Ronneburg war das der Fall. Im Jahre 1578 war dann die Wächtersbacher Brauerei mit neueren und größeren Geräten ausgestattet worden, und vom Grafen Wolfgang wurde ein Brauer namens Mathes Möller angestellt. Bereits zu dieser Zeit gab es feste Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die unter anderem Menge und Qualität des herzustellenden Bieres regelten. Die Brauer waren gehalten, das Bier ohne schädlichen Zusatz und mit guter Qualität herzustellen, die Arbeitsgeräte waren sorgsam zu pflegen und zu erhalten. Das Bier sollte außerdem heimischen Geschmacksvorstellungen entsprechen. In einem Dokument beurkundete Wolfgang Ernst, Graf zu Ysenburg und Büdingen 1621, dass seinem Bierbrauer Hans Kühleß befohlen wird, siebzig Malter Hopfen aus Eisenach einzukaufen. Die verschiedenen Zollstädte, die er dabei berührte, wurden gebeten, ihn ohne Zoll, sicher und ungehindert passieren zu lassen, da seit 1582 zwischen dem Hause Hessen und den Wetterauischen Grafen ein entsprechender Vertrag existiere. Notfalls sei dem Brauer sogar Hilfe zu gewähren. Die länderübergreifende Vereinbarung ist ein Beleg dafür, welche Bedeutung man dem Brauwesen zu damaliger Zeit beigemessen hat. Die Brautradition in Wächtersbach konnte mehr als 400 Jahre lang bis zur endgültigen Schließung 2008 auf hohem Niveau weitergeführt werden. Und obwohl der Getränkeausstoß im Laufe der Jahre von 5 000 auf 80 000 Hektoliter ganz enorm gesteigert werden konnte, reichte die Menge letztendlich nicht aus, um mit den Großbrauereien konkurrieren zu können. Die gepflegten Biere, wie zum Beispiel das Fürstenpils, konnten zunächst in der ganzen Region erfolgreich eingeführt werden, bis die übermächtige Konkurrenz mit einem vielfach größeren Ausstoß ihre Biere kostengünstiger herstellen und besser vermarkten konnte. Mit dem Ankauf des Brauereigeländes durch die Stadt Wächtersbach und schließlich dem Abriss des Sudhauses wurde 2018 das mit dem 2001 eingestellten Brauereibetrieb. schon angekündigte Ende besiegelt. Bis 2008 war in Teilen der Brauerei noch ein Auslieferungslager untergebracht. Positiv ist dabei festzustellen, dass mit dem Entfernen des 1959 erbauten Sudhauses das vorher 200 Jahre währende historische Ensemble von Marstall, Brauerei und Rentkammer um einen rechteckigen Innenhof mit Rosenhügel herum, im Zuge des Umbaus des historischen Stadtkerns, nun wiederhergestellt werden kann.
Die Gründung der Wächtersbacher Brauerei auf dem Gelände des Schlosses fiel in die Zeit nach Graf Antons Tod. Schon vor 1578 war Bier in kleineren Mengen nur zum Verzehr des kleinen Hofes, seiner Herrschaften und Diener gebraut worden, wie Otto Friedrich Fürst zu Ysenburg und Büdingen in seinem Flyer anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der Fürstlichen Brauerei Schloss Wächtersbach erklärte. Auch in Büdingen, Birstein und Ronneburg war das der Fall. Im Jahre 1578 war dann die Wächtersbacher Brauerei mit neueren und größeren Geräten ausgestattet worden, und vom Grafen Wolfgang wurde ein Brauer namens Mathes Möller angestellt. Bereits zu dieser Zeit gab es feste Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die unter anderem Menge und Qualität des herzustellenden Bieres regelten. Die Brauer waren gehalten, das Bier ohne schädlichen Zusatz und mit guter Qualität herzustellen, die Arbeitsgeräte waren sorgsam zu pflegen und zu erhalten. Das Bier sollte außerdem heimischen Geschmacksvorstellungen entsprechen. In einem Dokument beurkundete Wolfgang Ernst, Graf zu Ysenburg und Büdingen 1621, dass seinem Bierbrauer Hans Kühleß befohlen wird, siebzig Malter Hopfen aus Eisenach einzukaufen. Die verschiedenen Zollstädte, die er dabei berührte, wurden gebeten, ihn ohne Zoll, sicher und ungehindert passieren zu lassen, da seit 1582 zwischen dem Hause Hessen und den Wetterauischen Grafen ein entsprechender Vertrag existiere. Notfalls sei dem Brauer sogar Hilfe zu gewähren. Die länderübergreifende Vereinbarung ist ein Beleg dafür, welche Bedeutung man dem Brauwesen zu damaliger Zeit beigemessen hat. Die Brautradition in Wächtersbach konnte mehr als 400 Jahre lang bis zur endgültigen Schließung 2008 auf hohem Niveau weitergeführt werden. Und obwohl der Getränkeausstoß im Laufe der Jahre von 5 000 auf 80 000 Hektoliter ganz enorm gesteigert werden konnte, reichte die Menge letztendlich nicht aus, um mit den Großbrauereien konkurrieren zu können. Die gepflegten Biere, wie zum Beispiel das Fürstenpils, konnten zunächst in der ganzen Region erfolgreich eingeführt werden, bis die übermächtige Konkurrenz mit einem vielfach größeren Ausstoß ihre Biere kostengünstiger herstellen und besser vermarkten konnte. Mit dem Ankauf des Brauereigeländes durch die Stadt Wächtersbach und schließlich dem Abriss des Sudhauses wurde 2018 das mit dem 2001 eingestellten Brauereibetrieb. schon angekündigte Ende besiegelt. Bis 2008 war in Teilen der Brauerei noch ein Auslieferungslager untergebracht. Positiv ist dabei festzustellen, dass mit dem Entfernen des 1959 erbauten Sudhauses das vorher 200 Jahre währende historische Ensemble von Marstall, Brauerei und Rentkammer um einen rechteckigen Innenhof mit Rosenhügel herum, im Zuge des Umbaus des historischen Stadtkerns, nun wiederhergestellt werden kann.